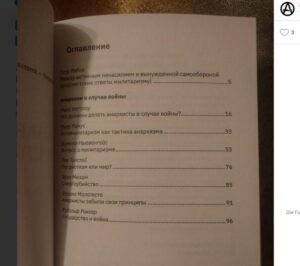[Предисловие к немецкому изданию «Основных принципов» Группы интернациональных коммунистов Голландии от 1970-го года, написанное Паулем Маттиком. Вот, собственно, тру-марксистский ответ на вопрос: «а как, собственно?» Мир, конечно, изменился с 1930-го, страшно представить — почти уже сто лет прошло с тех пор. Среди прочего изменились и расчётные мощности в глобализированном мире, вот отсюда и нужно будет начинать. Например, как одна Берлинская инициатива, которая занимается обсуждением и популяризацией идей рэтекоммунистов и разработкой мобильного приложения — для чего?Совершенно верно — для расчёта рабочего времени. Тонко намекаю: можно было бы перевести и кое-что конкретное, сами «Принципы», а не только исторические зарисовки о том, как деды воевали и какие они были хорошие. Но это пусть кто-нибудь другой. Что всё только я да я? – liberadio]
Пауль Маттик
Этот коллективный труд «Основные принципы коммунистического производства и распределения» был впервые опубликован 40 лет назад. Его авторы, группа международных коммунистов в Голландии, принадлежали к движению рабочих советов. Рабочие советы впервые возникли в ходе русской революции 1905-го года и, по мнению Ленина, уже тогда обладали потенциалом для захвата политической власти, хотя фактически ещё находились на почве буржуазной революции. По мнению Троцкого, рабочие советы, в отличие от политических партий внутри рабочего класса, представляли собой организацию самого пролетариата. Голландец Антон Паннекук рассматривал движение советов как самоорганизацию пролетариата, которая приведёт к его классовому господству и захвату производства. Однако с угасанием русской революции и прекращением деятельности советов интерес к этой новой форме организации угас, и традиционные политические партии и профсоюзы вновь получили поле рабочего движения в своё распоряжение. Именно русская революция 1917-го года вернула советы в поле зрения международного рабочего движения, но теперь уже не только как выражение стихийной организации революционных рабочих, но и как необходимую меру против контрреволюционных настроений старого рабочего движения.
Первая мировая война и крах Второго Интернационала завершили первый период рабочего движения. То, что было очевидно задолго до этого, а именно интеграция рабочего движения в буржуазное общество, теперь стало неоспоримым фактом. Рабочее движение было не революционным движением, а движением рабочих, стремящихся утвердиться в рамках капитализма. Не только лидеры, но и сами рабочие не были заинтересованы в ликвидации капитализма и поэтому довольствовались профсоюзной и политической деятельностью в рамках капитализма. Ограниченные возможности партий и профсоюзов в рамках буржуазного общества также выражали реальные интересы рабочего класса. Ничего другого ожидать было нельзя, поскольку прогрессивно развивающийся капитализм исключает возможность реального революционного движения.
Однако идиллия возможной классовой гармонии в процессе трансформации капиталистического развития, лежавшая в основе реформистского рабочего движения, была разрушена противоречиями, присущими капитализму, которые выражались в кризисах и войнах. Революционная идея, первоначально являвшаяся идеологическим достоянием радикального меньшинства в рабочем движении, овладела широкими массами, когда страдания войны обнажили истинную природу капитализма, и не только капитализма, но и истинный характер рабочих организаций, выросших при капитализме. Эти организации вырвались из рук рабочих; они существовали для них лишь постольку, поскольку это было необходимо для обеспечения существования их бюрократии. Поскольку функции этих организаций связаны с сохранением капитализма, они не могут не противостоять любой серьёзной борьбе против капиталистической системы. Поэтому революционное движение нуждается в организационных формах, выходящих за рамки капитализма, восстанавливающих утраченное господство рабочих над своими организациями и охватывающих не только части рабочих, но и всех рабочих как класс. Советское движение было первой попыткой построить форму организации, соответствующую пролетарской революции.
И русская, и немецкая революции нашли своё организационное выражение в советском движении. Однако в обоих случаях им не удалось утвердить политическую власть и использовать её для построения социалистической экономики. Если неудача российского движения советов, несомненно, объяснялась социально-экономической отсталостью России, то неудача германского движения советов объяснялась нежеланием трудящихся масс реализовать социализм революционным путём. Обобществление рассматривалось как задача правительства, а не самих рабочих, и советское движение декретировало свой конец через восстановление буржуазной демократии.
Хотя большевистская партия захватила политическую власть под лозунгом «Вся власть советам», она придерживалась социал-демократической идеи, что введение социализма — дело государства, а не советов. В то время как в Германии не было проведено никакого обобществления, большевистское государство уничтожило капиталистическую частную собственность, не предоставив, однако, рабочим права распоряжаться своей продукцией. Что касается рабочих, то в результате возникла форма государственного капитализма, которая оставила социальное положение рабочих без изменений и продолжила их эксплуатацию вновь образованным привилегированным классом. Социализм не мог быть реализован ни реформированным государством буржуазной демократии, ни новым революционным большевистским государством.
Помимо объективной или субъективной незрелости ситуаций, пути социализации также были окутаны мраком. В целом социалистическая теория была сосредоточена на критике капитализма, стратегии и тактике классовой борьбы в буржуазном обществе. В той мере, в какой люди задумывались о социализме, путь к нему и его структура уже были прописаны в капитализме. Даже Маркс оставил лишь несколько принципиальных замечаний о характере социалистического общества, поскольку, действительно, не очень выгодно беспокоиться о будущем дальше той точки, которая уже заключена в прошлом и настоящем.
Однако, в отличие от более поздних взглядов, Маркс ясно дал понять, что социализм — это дело не государства, а общества. Социализм как «ассоциация свободных и равных производителей» нуждался в «государстве», то есть в диктатуре пролетариата, только для того, чтобы утвердиться. С укреплением социализма диктатура пролетариата, задуманная как «государство», исчезла. Однако как в реформистской, так и в революционной социал-демократической концепции произошло отождествление государственного и общественного контроля, а понятие «ассоциация свободных и равных производителей» утратило свой первоначальный смысл. Черты социалистического будущего, присутствующие в капитализме, виделись не в возможной самоорганизации производства и распределения производителями, а в свойственных капитализму тенденциях к концентрации и централизации, кульминацией которых станет государственный контроль над экономикой в целом. Эта идея социализма была подхвачена буржуазией, а затем подвергнута нападкам как иллюзия. Continue reading →