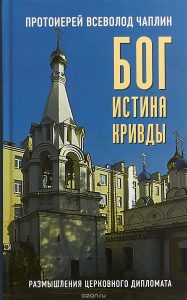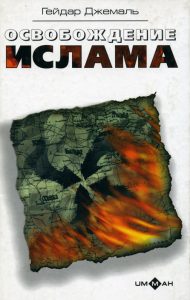 Не то, чтобы мне сильно хотелось пинать и без того дохлых собак, но перебирал давеча старые книги, нашёл эпическую «Освобождение ислама» Гейдара Джемаля (2004, Москва). Перелистал, похихикал и поставил книгу на улице в шкаф бук-кроссинга, с глаз долой. До сих пор не понимаю, как он мог произвести столь сильное впечатление не только на экзальтированых любителей «скрытых истин», но и на российских левых. (Пост-)Традиционалист или «новый правый», как принято говорить в Европе, и сооснователь «Левого фронта»… Но в связи с книгой возникли интересные ассоциации.
Не то, чтобы мне сильно хотелось пинать и без того дохлых собак, но перебирал давеча старые книги, нашёл эпическую «Освобождение ислама» Гейдара Джемаля (2004, Москва). Перелистал, похихикал и поставил книгу на улице в шкаф бук-кроссинга, с глаз долой. До сих пор не понимаю, как он мог произвести столь сильное впечатление не только на экзальтированых любителей «скрытых истин», но и на российских левых. (Пост-)Традиционалист или «новый правый», как принято говорить в Европе, и сооснователь «Левого фронта»… Но в связи с книгой возникли интересные ассоциации.
У Джемаля есть всё, что на самом деле так любо моему сердцу:
прикрывающийся «благородным антисионизмом» антисемитизм –
«Дело в том, что Израиль никакого отношения не имеет к иудаизму. Это на самом деле продолжение Иерусалимского королевства Болдуина. Что такое Израиль? Говорится, что это евреи. Но на самом деле это вторжение Запада, который вновь, как и в средневековье, влез туда и институционализировал захват Иерусалима. Только раньше это были крестоносцы, теперь же по технческим причинам это нельзя сделать в такой же форме, поэтому были использованы евреи. Но это не евреи, это представители Запада, и Израиль – это представители Запада. Израиль – это Иерусалимское королевство. Это восстановление средневековой западной оккупации. Израиль – это продолжение Рима, это не то, что иудаизм. Иудаизм же там подавлялся: если подлинные иудеи, протестующие против сионизма, выходят на демонстрации, их бьют по головам». С. 60
Теории заговора –
«Следует отдельно отметить так называемый проект Великая Хазария. Сегодня перед Россией стоит реальная угроза политического перерождения, превращения в некую структуру, котоая технологически с некоторых сторон напоминает государство, существовавшее в 6-10 веках на территории России, где, как вы знаете, иудейская элита правила тюркскими массами. Сегодня существует проект создать аналогичное госудасртво, где иудейская элита, замкнув эту империю на себя, будет управлять ею под национал-патриотическими великодержавными лозунгами. Для реализации этого проекта необходимо прежде всего исключить мусульман из политического поля России, физически вывести их за рубежи России». С. 319
Ленинизм (без филантропического марксизма) как истинно верное учение джихадизма – Continue reading